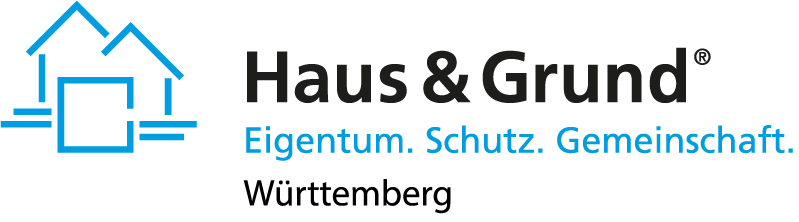


70182 Stuttgart
Tel.: 0711 - 23765-0
Fax: 0711 - 23765-88
Pressemitteilung vom 11.07.2013
Haus & Grund gegen die Verschärfung des EWärmeG
Haus- und Grund Württemberg lehnt die geplante Verschärfung des Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg (EWärmeG) ab. Aus Sicht der Haus und Grundbesitzer hat schon die bisherige Fassung nicht die gewünschten Ziele erreicht. In einem Brief an Umweltminister Untersteller hat der Verband seine Kritik im Einzelnen begründet.
„Es ist schon erstaunlich, dass ein Gesetz verschärft werden soll, das sich bisher als Misserfolg herausgestellt hat“ so Ottmar H. Wernicke, Geschäftsführer von Haus & Grund Württemberg. „Statt die Zahl der Heizungsmodernisierungen zu steigern, hat das Gesetz das genaue Gegenteil erreicht. Damit ist erwiesen: mit gesetzlichem Zwang ist die Energiewende nicht zu stemmen. Wir hoffen, dass die Landesregierung unsere begründete Kritik nicht nur hört, sondern auch erhört.“
Im Einzelnen wendet sich der Verband gegen folgende Maßnahmen:
1. Erhöhung des Pflichtanteils an erneuerbaren Energien von 10 Prozent auf 15 Prozent
Bei einem Austausch des Heizkessels ist der Hauseigentümer bisher verpflichtet, 10 Prozent des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien zu gewährleisten. Der Pflichtanteil soll von 10 Prozent auf 15 Prozent erhöht werden.
Die vorgesehene Erhöhung des Pflichtanteils um 50 Prozent lehnt Haus & Grund ab. Statt die Modernisierungsquote durch finanzielle und/oder steuerliche Anreize zu steigern, wird der gesetzgeberische Zwang erhöht. Mit der Folge, dass die Zahl der Heizungsmodernisierungen durch das EWärmeG weiter zurückgehen wird, wie auch dem Erfahrungsbericht der Landesregierung zu entnehmen ist. Das EWärmeG Baden-Württemberg hat sich als gesetzgeberischer Misserfolg herausgestellt. Dies zeigt sich auch daran, dass bisher kein anderes Bundesland dieses Gesetz übernommen hat. Daher sollte man dieses auch nicht weiter verschärfen.
Die Erhöhung des Pflichtanteils führt weiter zu einer massiven Kostenbelastung der Gebäudeeigentümer. Allein im Bereich der Solarthermie (siehe Ziffer 4) um das Doppelte.
2. Streichung der Erfüllungsoption Bioöl
Den Pflichtanteil an erneuerbaren Energien durch die Verwendung von Bioöl zu erfüllen, soll ersatzlos entfallen.
Dies lehnen wir entschieden ab, denn damit entfiele die bisherige „Sozialklausel“ dieses Gesetzes, für die sich Haus & Grund bei der Einführung des EWärmeG nachhaltig eingesetzt hat. Viele ältere Häuser gehören
älteren Menschen, die sich bereits im Rentenalter befinden. Diese Personengruppe zu kostenintensiven Maßnahmen am Gebäude zu zwingen, unabhängig davon, ob sich diese dazu finanziell in der Lage sehen,
halten wir für unsozial. Es muss gewährleistet sein, dass auch Menschen mit geringem Einkommen und damit einhergehender mangelnder Darlehenswürdigkeit nicht gezwungen werden, ihre Immobilie verkaufen zu müssen. Die mögliche enteignungsgleiche Wirkung dieser Maßnahme muss unterbleiben.
Des Weiteren würde die Bevölkerung im ländlichen Raum durch die geplante Abschaffung der Erfüllungsvariante „Bioöl“ benachteiligt. Denn dort kann - mangels Bezugsmöglichkeit von Biogas - keine Verringerung der Anforderungen an den Einsatz erneuerbarer Energien durch die Kombination „Biogas + Sanierungskonzept“ erreicht werden. Diese Benachteiligung der Bevölkerung im ländlichen Raum ist weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt.
3. Verzicht auf die Solarthermie als Ankertechnologie
Kann derzeit bei einem Kesselaustausch eine Solarthermieanlage auf dem Dach des Gebäudes nicht wirksam angebracht werden, muss auch keine andere Option des Gesetzes erfüllt werden. Die gesetzliche Pflicht entfällt dann bisher ganz. Daher wird die Solarthermie als Ankertechnologie bezeichnet.
Den Verzicht auf die Solarthermie als Ankertechnologie lehnen wir ab. Denn durch deren Wegfall und der Streichungen der Erfüllungsoption Bioöl (siehe Ziffer 2) soll der Eigentümer gezwungen werden, am
Gebäude technische Modifikationen vorzunehmen. Diesen Modernisierungszwang halten wir für kontraproduktiv. Stattdessen sollten Modernisierungsanreize, vor allem in steuerlicher Hinsicht, geschaffen werden.
4. Solarthermie
Es ist vorgesehen, die Kollektorfläche von 0,04 m2 auf 0,07 m2 Kollektorfläche je m2 Wohnfläche anzuheben (bei Ein-/Zweifamilienhäusern auf 0,06 m2 Kollektorfläche pro m2 Wohnfläche).
Diesen Steigerungsfaktor halten wir für überzogen. Die Kosten für eine Solarthermieanlage würden dadurch um mindestens 50 Prozent steigen. Bei einem Kostenansatz von € 2.000 pro m2 Kollektorfläche brutto sind bisher bei bspw. 100 m2 Wohnfläche € 8,000 aufzuwenden, nach der Novellierung € 12.000. Dazu kommen noch die Kosten für den Austausch der Heizanlage, die mit mindestens € 10.000 anzusetzen sind.
5. Fotovoltaik
Im Eckpunktepapier heißt es, „auch die Möglichkeit der Erfüllung durch Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie (Fotovoltaik) soll weiter erhalten bleiben“.
Diese Formulierung ist irreführend und nicht korrekt. Die Anbringung von Fotovoltaikanlagen war bisher nicht als Erfüllungsmöglichkeit vorgesehen. Insofern kann nicht von „erhalten bleiben“ gesprochen werden.
Sofern zukünftig alternativ anstatt einer Solarthermieanlage auch eine Fotovoltaikanlage erstmalig als Erfüllungsoption vorgesehen werden soll, würden wir dies gutheißen.
6. Erhöhte Anforderung an die Erfüllungsoption Biogas
Bei einer thermischen Gesamtleistung des Gebäudes von weniger als 50 KW soll Biogas nur mit der zusätzlichen Komponente „Sanierungskonzept“ möglich sein.
Dies bevorzugt einseitig die Bevölkerung in den Räumen, in denen Biogas verfügbar ist. Daran fehlt es überwiegend im ländlichen Raum. Warum es hier zu einer einseitigen Bevorzugung der Gebiete mit Gasversorgung kommen soll, ist weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt.
Bei einer thermischen Gesamtleistung des Gebäudes ab 50 KW (ca. 6-Familien-Haus) muss beim Einsatz von Biogas ein Blockheizkraftwerk eingebaut werden.
Diese Einschränkung der Erfüllungsoption Biogas lehnen wir aus Kostengründen ebenfalls ab.
7. Gebäudeindividuelles Sanierungskonzept
Die Erstellung eines gebäudeindividuellen Sanierungskonzepts (Sanierungsfahrplans) soll zu einer Reduktion des Pflichtanteils von 15 Prozent auf 10 Prozent führen.
Diese Möglichkeit zur Reduzierung des Pflichtanteils begrüßen wir im Grundsatz. Doch dass die im Eckpunktepapier genannten Varianten
• Sanierungskonzept + 10 Prozent Solarenergie
• Sanierungskonzept + 10 Prozent Biogas, wenn Heizlast < 50 KW
• Sanierungskonzept + Kellerdeckendämmung bei Gebäuden mit maximal zwei Geschossen,
jedoch nicht auch die Variante
• Sanierungskonzept + 10 Prozent Bioöl
umfassen soll, wird aus den unter Ziffer 9 (Bioöl) genannten Gründen abgelehnt. Wir fordern vielmehr, gerade diese Variante zuzulassen.
8. Anforderungen an das Sanierungskonzept
Die Einzelheiten zur Erstellung des Sanierungskonzepts sollen noch definiert werden. Es soll nur durch qualifizierte Personen erfolgen dürfen.
Die Einführung eines Sanierungskonzepts bedarf der Verknüpfung mit einheitlichen technischen Standards, Software und einem qualifizierten Erstellerkreis. Die Erfahrungen mit dem Gebäudeenergieausweis auf
Bedarfsbasis haben gezeigt, dass enorme Spreizungen bei den Ergebnissen bei ein und demselben Gebäude durch verschiedene Standards und Berater möglich sind. Dies gilt es zu vermeiden. Ansonsten zu befürchten ist, dass interessengetriebene Ergebnisse produziert werden, die den Namen Sanierungskonzept nicht verdienen.
9. Einbeziehung von Nicht-Wohngebäuden in das EWärmeG
Es sollen Nicht-Wohngebäude in den Anwendungsbereich des EWärmeG einbezogen werden.
Die Einbeziehung ist folgerichtig. Denn es war schon bisher nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund nur Wohngebäude unter das EWärmeG fallen sollten. Die vorgesehene Umsetzung halten wir jedoch für misslungen. Denn die Erstellung eines Sanierungskonzeptes soll bei Nicht-Wohngebäuden ausreichen, das Gesetz zu erfüllen. Diese Erleichterung soll aber Eigentümern von Wohngebäuden verwehrt bleiben. Es drängt sich der Eindruck auf, dass mit dieser „Feigenblatt-Lösung“ öffentlichkeits-wirksam die Einbeziehung von Nicht-Wohngebäuden suggeriert werden soll.
10. Einführung eines Betretungsrechtes
Es soll ein Betretungsrecht im EWärmeG (analog zum EEWärmeG des Bundes) eingeführt werden, um den Vollzug der gesetzlichen Maßnahmen leichter überprüfen zu können.
Eine weitere Einschränkung der Eigentümerrechte lehnen wir ab. Die vorgesehene Regelung halten wir für unverhältnismäßig und verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Vollzugserleichterungen bedarf es
nicht. Die im Verwaltungsrecht vorgesehenen Zwangsmaßnahmen reichen völlig aus.
11. Zusammenfassung
Als Folge der geplanten Novellierung des EWärmeG droht
• eine Verschärfung des Sanierungsstaus.
• eine Verlangsamung der Umsetzung der Energiewende.
• der Zwangsverkauf von Wohngebäuden, die älteren Menschen gehören.
• eine soziale Schieflage.
• eine Benachteiligung des ländlichen Raumes und seiner Bewohner.
• die Entscheidungsfreiheit bei der Wahl der Heizenergie nachhaltig beschnitten zu werden zugunsten eines gesetzlichen Modernisierungszwangs.